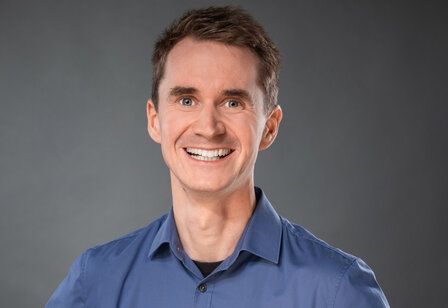Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist. Für die zukünftige Welt unserer Kinder ist die Fähigkeit kreativ zu denken wichtig. Noch befinden wir uns am Anfang im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI). Immer weiter entwickelt sich die KI in allen Bereichen des Lebens. Die neue Generation kann davon profitieren unabhängig bzw. neben Datenmengen und Algorithmen Probleme anzugehen. Sprich die KI nutzen, sie richtig lenken und Dinge immer wieder hinterfragen. Zu Hause fing KI an mit: „Alexa: Spiel mir Lemon Tree der Beatles“. Inzwischen kann man bereits einen astreinen letzten Beatles-Song hören, der vollständig mit KI erstellt ist. Im Arbeitsleben ist KI auch omnipräsent. Juristische Hilfskräfte oder Steuerberater fragen sich schon länger: wie lange habe ich noch meinen Job? Relativ sicher gelten noch Berufe, die hohes abstraktes Denkvermögen verlangen. Berufe, in denen Menschen Entscheidungen treffen und dafür Optionen gegeneinander abwägen müssen. Berufe, bei denen es um Entwicklung und Innovation geht, seien weniger bedroht. Dort wo Fragen gestellt und Dinge hinterfragt werden. Kreativität ist also mehr wert denn je. Es wird immer Menschen brauchen, die Fragen proaktiv stellen zur Veränderung der Welt und nicht nur zur Optimierung dieser– und zwar mit einer persönlichen oder gesellschaftlichen Absicht dahinter. Diese Kunst zu hinterfragen ist umso wichtiger, je digitaler unsere Welt wird, findet Neurowissenschaftler und Kreativitätsforscher Henning Beck.?
Wie und wann entsteht eigentlich die Kreativität?
Zur Ideenfindung braucht es ein Wechselspiel zwischen Bereichen im vorderen Teil des Gehirns, die für Konzentration und Aufmerksamkeit zuständig sind, und Arealen im hinteren Bereich, die immer dann aktiv sind, wenn wir abschweifen. Das Default-Mode-Netzwerk ist dann aktiv, wenn wir gedanklich umherwandern. Das Kontroll- und Entscheidungsnetzwerk arbeitet, wenn wir voll konzentriert sind. Die zündende Idee entsteht immer aus einem Wechsel aus Abschweifen und Fokussieren. Dabei bringt das Gehirn beim Tagträumen erst jede Menge, teils abwegiger Ideen hervor, die dann durch das Kontrollzentrum auf ihre Brauchbarkeit hin überprüft werden. Kreativität entwickelt sich laut Henning Beck zusammenhängend mit dem Bewusstsein. Wenn ein Kind sich selbst bewusst ist und aktiv Entscheidungen trifft, kann Kreativität entdeckt und gefördert werden. Die bewusste Willensentscheidungen ist also Grundlage dafür als kleines Kind kreative Ideen zu entwickeln. Heute neigen wir schnell dazu zu digitalen Helfern wie Google, Chatbot oder Alexa zu greifen. Beck betont, dass diese Hilfsmittel als Assistenz gut sind, aber sobald sie uns daran hindern selbstständig zu denken, ist es gefährlich. Wir Erwachsene sind tatsächlich nicht die idealen Vorbilder. Sofort fragen wir Google. Besser ist es die Kinder an unserem Denkprozess teilhaben zu lassen. Und ein wichtiger Tipp von Beck: die Kinder zum Hinterfragen und Nachdenken animieren. Warum macht der Maulwurf einen Hügel? Diese Frage kannst Du wunderbar zurückgeben, anstatt direkt eine Antwort zu liefern. Am Ende sollte das Kind Bescheid wissen, aber den Prozess dahin kann man ganz wunderbar gemeinsam gestalten.
Fantasie und komplexes Denken
Fantasie und Kreativität sind nicht zu verwechseln, laut Beck. Mit Kreativität werden neuartige Lösungswege aufgezeigt und klassische Lösungswege umgangen. Kreativer Fortschritt entsteht durch Regelbruch. Dafür muss aber zunächst ein Problem in seiner Vielschichtigkeit verstanden werden. Kinder durchdringen eine komplexe Aufgabe noch nicht in dem Maße, wie die Erwachsenen es tun. Dennoch kann den Erwachsenen der Blick eines Kindes auf ein hochkomplexes Problem sogar in bestimmten Fällen helfen, da sie noch einen grenzenlosen, unreflektierten Blickwinkel ohne jegliche Bewertung haben. Komplexe Denken und eigenständig Problemlösungsstrategien werden in der Grundschule nach und nach erlernt und gefördert. Aus evolutionärer Sicht und somit hirnphysiologisch ist dieses komplexe Denken erst in der neueren Zeit so wichtig geworden. Früher ging es um reine Tat-Folge-Zusammenhänge. Ein Tier greift an, der Mensch rennt weg. Wer keine Vorräte anlegt, hungert im Winter. Gerade in Bezug auf globale Problemlagen sind aber die unmittelbaren Tat-Folge-Zusammenhänge hinfällig. Ein komplexeres Denken musste stattfinden. Kinder im Grundschulalter sind bereits in der Lage die Vielschichtigkeit komplexer Themen zu erkennen, verschiedene Perspektiven auf ein Thema nachzuvollziehen und miteinander in Beziehung zu setzen – und so möglicherweise differenzierte Lösungen für mehrdimensionale Probleme zu entwickeln. Wenn im Regenwald Bäume abgeholzt werden, liegt das unmittelbar im Interesse von Umsatzinteressen von Konzernen während die langfristigen negativen Folgen für Klima und Ökologie nicht sofort greifbar sind. Solche Themen besprechen die Kinder bereits in der Grundschule im Sachunterricht, sprich ab dem 6. Lebensjahr.
Kreativität fördern in der Schule und zu Hause
Den Kindern in der Schule soll viel Wissen vermittelt werden, auf das sie zurückgreifen können. Kreativität ist eine Neuformierung von vorhandenen Informationen. Die Ideen, aus denen das Gehirn auswählt, müssen ja irgendwo herkommen. Und auch die Auswahl durch das Kontrollnetzwerk basiert auf vorhandenem Wissen. Eine druckfreie Umgebung fördert Kreativität. Stehen wir unter Stress, schaltet unser Gehirn in den Notfallmodus: Es gilt dann möglichst keinen Fehler zu machen. Das Kind soll sich sicher und wertgeschätzt fühlen, sonst wird es kaum kreativ werden. In der Schule soll eine gute Fehlerkultur herrschen. Des Weiteren ist das Anbieten von Materialien und sinnlichen Anregungen wichtig um Begeisterung zu wecken. Der Einsatz verschiedenster Materialien, Gerüche, Töne, Medien soll die Bandbreite aller Sinne stimulieren und somit jede:n Einzelne:n erreichen.
Und wie können wir die Kreativität der Kinder als Eltern fördern?
Genauso wie in der Schule. Ein druck- und wertfreier Raum, Anregungen, Input und Freiraum schaffen. Die Tendenz der Eltern möglichst viele Freizeitaktivitäten für ihre Kinder zu organisieren, kann man häufig beobachten. Sportliche und musikalische Hobbys, die sich mit Verabredungen mit Freunden innerhalb einer Woche abwechseln. Damit aber kreatives Spiel entstehen kann, brauchen Kinder Freiraum. Keinen Zeitdruck, keine Vorgaben und schon kann ein Bett als Segelschiff umdefiniert werden. Raum für Langeweile ist wichtig für die kreative Entfaltung. Wenn Kinder spielen, erleben wir sie oft im „Tätigkeitsrausch“, im sogenannten Flow. Dieser der Psychologie entlehnte Begriff bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit. Wir alle kennen den Zustand, wenn wir vollständig in etwas vertieft sind, Zeit und Raum und das gesamte Drumherum vergessen. Im Flow sein ist ein Zustand, bei dem häufig kreative Ergebnisse entstehen. Kinder haben häufig diese Zustände. Das liegt auch daran, dass sie viel Aktivitäten machen, die zu einem konkreten Ergebnis führen, wie beim Basteln und Bauen. Das Schöne bei diesem Tätigkeitsrausch der Kinder ist – sie sind frei von Bewertungen. Es ist an dieser Stelle wichtig, die Kinder einfach mal sein zu lassen und uns mit unseren Bewertungen und Ideen zurückzunehmen. Und wie oben erwähnt, eine gestellte Frage des Kindes einfach mal zurückgeben und uns von den einzigartigen Antworten überraschen lassen.